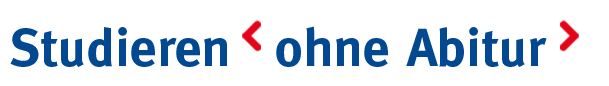Nachfrage beim Studium ohne Abitur weitgehend konstant
Im Jahr 2023 sind rund 69.000 Studierende ohne (Fach-)Abitur an einer deutschen Hochschule eingeschrieben. Das entspricht einem Anteil von 2,4 Prozent an allen Studierenden im Bundesgebiet. Die Quote bleibt unverändert auf dem bisherigen Höchstwert. Im Zeitverlauf zeigt sich ein deutlicher Anstieg: 1997 haben 8.447 Personen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung (HZB) studiert, was einem Anteil von 0,5 Prozent entspricht.
Dritter Bildungsweg deutlich etablierter als noch vor 25 Jahren
Insgesamt wurden seit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) zum „Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung“ im Jahr 2009 bereits mehr als 95.000 beruflich qualifizierte Hochschulabsolvent*innen erfolgreich in den Arbeitsmarkt entlassen. Die absolute Zahl der Hochschulabsolvent*innen ohne (Fach-)Abitur liegt seit 2017 konstant zwischen 8.000 und 9.500 Personen und hat sich somit auf relativ hohem Niveau eingependelt. Im Jahr 2023 beträgt der Anteil an allen Hochschulabsolvent*innen bundesweit 1,9 Prozent, was 9.499 Personen entspricht. Ein Studium über den sogenannten „Dritten Bildungsweg“ zu beginnen und am Ende erfolgreich abzuschließen, ist damit in Deutschland deutlich normaler geworden als vor 25 Jahren. Die obige Abbildung zeigt, dass ein Studium ohne (Fach-)Abitur immer noch eher die Ausnahme als die Regel ist – die Zahl der Ausnahmen ist jedoch deutlich gestiegen.
Bei den Erstsemestern ohne allgemeine Hochschul- und Fachhochschulreife bleibt die Zahl im Jahr 2023 konstant bei knapp 13.000, was einem Anteil von 2,6 Prozent an allen Studienanfänger*innen entspricht. Im Vorjahr lag dieser noch marginal höher bei 2,7 Prozent. Mit Blick auf die bundeslandspezifischen Entwicklungen zeigt sich, dass es in der Hälfte der Bundesländer im Vergleich zum Vorjahr anteilig mehr Studienanfänger*innen ohne (Fach-)Abitur gab (vgl. Quantitative Entwicklung in den Bundesländern).Der Abwärtstrend zeigt sich auch mehr oder weniger deutlich bei den Hochschulen mit den bundesweit meisten Studienanfänger*innen ohne allgemeine Hochschul- und Fachhochschulreife. Hierbei handelt es sich um neun Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) und eine Universität. Sieben der Einrichtungen befinden sich in privater und drei in staatlicher Trägerschaft. Einen Überblick gibt die nachfolgende Tabelle, in der bei Hochschulen mit mehreren Standorten alle Hochschulstandorte zusammengezählt wurden:
Die IU Internationale Hochschule hat insgesamt 1.187 Studienanfänger*innen ohne schulische HZB aufgenommen, während es im Vorjahr noch 1.922 waren (minus 735). Danach folgen die FernUniversität in Hagen mit einer gestiegenen Anzahl an Studienanfänger*innen ohne (Fach-)Abitur (plus 126), die FOM Hochschule für Oekonomie und Management (plus 67) und die DIPLOMA Hochschule – Private Hochschule Nordhessen (plus 156). Gleiches gilt für die beiden Fernhochschulen in Hamburg. So gab es an der Europäischen Fernhochschule Hamburg 88 und an der Hamburger Fern-Hochschule 34 Studienanfänger*innen ohne (Fach-)Abitur mehr. Dennoch haben sich insgesamt betrachtet vor allem an privaten Hochschulen weniger Erstsemester aus dieser Gruppe eingeschrieben. Lag der Anteil der Studienanfänger*innen ohne (Fach-)Abitur an privaten Hochschulen im Jahr 2021 noch bei insgesamt 48 Prozent, beläuft er sich im aktuellen Berichtsjahr auf 38,5 Prozent (vgl. Hochschultyp und Trägerschaft). Auf dem sechsten und siebten Platz stehen zwei staatliche FH/HAW: die Hochschule Koblenz und die Duale Hochschule Baden-Württemberg. An beiden Hochschulen ist die Anzahl an Erstsemestern gestiegen. Danach folgen wieder zwei private Hochschulen, und zwar die APOLLON Hochschule der Gesundheitswissenschaften (minus 63) und die Fachhochschule des Mittelstands (plus 64) und die .
Beruflich Qualifizierte ähnlich erfolgreich wie traditionell Studierende
Bundesweite Untersuchungen zum Studienerfolg und zum Abbruchverhalten von beruflich qualifizierten Studierenden gibt es in Deutschland wenige und wenn, kommen sie oft zu widersprüchlichen Aussagen. Ein Forschungsprojekt des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) und der Humboldt-Universität zu Berlin kommt zu dem Ergebnis, dass beruflich qualifizierte Studierende ohne (Fach-)Abitur oder Fachhochschulreife ähnlich erfolgreich sind wie Studierende mit (Fach-)Abitur. So unterscheiden sich die Abschlussnoten nicht-traditionell Studierender kaum von denen der Studierenden mit (Fach-)Abitur oder Fachhochschulreife. Beim Abbruch zeigt sich hingegen ein höheres Risiko, was darauf zurückgeführt wird, dass diese Personengruppe häufig in Fernstudiengängen eingeschrieben ist (Dahm & Kerst 2019: Wie erfolgreich sind Studierende mit und ohne Abitur? Ein bundesweiter Vergleich zu Studienerfolg und Studienleistungen). Auch die Ergebnisse einer aktuellen Studie zeigen, dass nicht-traditionell Studierende trotz guter Studienleistungen einem erhöhten Abbruchrisiko unterliegen (Herrmann 2022: Abbruchgründe nicht-traditioneller Studierender – Identifikation von Clustern mittels Data Mining). Dagegen zeigt die Evaluation des Modellversuchs zum Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte in Hessen, dass beruflich Qualifizierte ihr Studium im ersten Studienjahr nicht häufiger abbrechen als traditionell Studierende. Wie auch bei traditionell Studierenden ist bei den beruflich Qualifizierten ein erfolgreicher Studienbeginn (erreichte ECTS im ersten Semester) maßgeblich für einen erfolgreichen Studienverlauf (Greinert et al. 2022: Evaluation des Modellversuchs zum Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte in Hessen).
Dahm (2022) identifizierte in einem Vergleich mit traditionell Studierenden Einflussfaktoren für das Risiko eines Abbruchs. Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist dabei die soziodemografische Dimension, was bedeutet, dass nicht-traditionell Studierende häufiger Kinder haben, erwerbstätig sind und/oder andere Verpflichtungen haben. Ebenfalls wurde festgestellt, dass nicht-traditionell Studierende ihre Studienerfolgswahrscheinlichkeiten geringer beurteilen als ihre Kommiliton*innen (Dahm 2022: Warum brechen nicht-traditionelle Studierende häufiger ihr Studium ab? Eine Dekompositionsanalyse). Laut einer weiteren Studie des DZHW haben Studierende ohne (Fach-)Abitur vor allem in der Anfangsphase des Studiums ein höheres Abbruchrisiko als Studierende mit allgemeiner Hochschulreife oder Fachhochschulreife. Je länger sich beruflich qualifizierte Studierende jedoch im Studium befinden, desto weniger unterscheiden sie sich von traditionell Studierenden und sind ähnlich erfolgreich (Wolter et al. 2017: Nicht-traditionelle Studierende: Studienverlauf, Studienerfolg und Lernumwelten). Die Corona-Pandemie zeigte in den ersten vorliegenden Studien bisher keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppen von Studierenden und deren Abbruchverhalten (Freitag, Kerst & Ordemann 2022: Besonders belastet und kurz vor dem Abbruch? Nicht-traditionelle Studierende zu Beginn der COVID-19-Pandemie).
Zu beachten ist, dass die Studienabbruchquote im deutschen Hochschulsystem allgemein sehr hoch ist. So lag die Studienabbruchquote im Bachelorstudium 2020 im Bundesdurchschnitt bei 31 Prozent, wobei die Abbruchneigung an Universitäten höher ist als an Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Im Vergleich zum Bachelorstudium brechen deutlich weniger Masterstudierende ihr Studium ab. An Universitäten und Fachhochschulen liegt der Anteil hier durchschnittlich bei 23 Prozent (Heublein; Hutzsch & Schmelzer 2022: Die Entwicklung der Studienabbruchquoten in Deutschland).